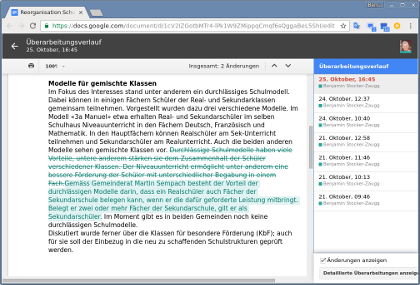Scho als Ching han i mi immer gfreut uf e erscht Schnee. Denn, wenn d Tage sy chürzer worde, wenn der chalt Herbschtluft ds letschte farbige Loub vo de Böim het g’chutet u wenn am Morge der erscht Bodefroscht uf de Matte isch gläge, denn han i blanget. U we’s de z’grächtem isch chalt worde und e ruuche Wind der Räge het i ds Land treit, de bin i a ds Fäischter gstande u ha usegluegt, ha mit Chinderouge uf die erschte Schneeflocke am graue Himmel gwartet.
D Gschicht vo der Tanne
So lang isch das scho här! Mängs, mängs Jahr isch syt dene Erinnerige vergange. U mänge chalte Winter han i erläbt, wie o mänge heitere u milde Summer. U d Haar uf mim Chopf si wie der Schnee worde: ganz wiss. O itz hocken-i i der warme Stube am Fäischter u luege i ne trüebe Spätherbschttag use. Aber miner Gedanke sy nid trüeb, nei, si si voll vo schöne Erinnerige a d Chinderzyt und a nes längs, guets Läbe! Mängisch han i d Frucht uf em Fäld gseh rif wärde, ha gseh wie d Öpfel am Boum sy lüchtend rot worde, wie alles isch gwachse u Säge für üs Mönsche het brunge. Glicht so es Mönscheläbe nid der Frucht uf em Fäld? Dass mir wachse und mit all üsem Sinne u Sträbe e Säge für angeri Mönsche dörfe sy?

«Grossätti, Grossätti», het da plötzlich e hälli Chinderstimm vor em Hus grüeft u het mi vo eim Momänt zum andere us em Sinne u Erinnere i ds Hier u Itz zrügg greicht. Es isch d Miriam gsi, mis jüngschte Grosschind. Zäme mit em Peterli und es paar Gspänli vom Nachberhuus isch äs i d Stube gstürmt u scho im nächschte Ougeblick vor mir am länge Tisch gstande. «Grosätti, erzellsch üs no einisch d Gschicht vo dire grosse Tanne?» het d Miriam itz gfragt u het mi mit erwartigsvolle, grosse Ouge agluegt. D Gschicht vo der Tanne? Gärn erzelle i euch die no einisch. Aber eigentlich isch ja gar nüt apartigs dran, es isch e Gschicht, wie si jede Tag u überall uf der Wält cha passiere. D Gschicht vo dere Wisstanne, wo scho mängs Jahr am Hoger ob üsem Buurehus wachst. Ganz elei steit si dert, u will si elei jedem Wind u Wätter muess entgäge ha, isch e chreftige Boum mit feschte Wurzle u breite Tannescht drus worde.
Die Tanne isch fascht so alt, wie i sälber, han i druf der Chinder erzellt. Meh als 70 Jahrringe het si i ihrem Stamm. I sälber ha se gsetzt, wo-n i so alt bi gsy wie Dir jetz. Mir hei denn e Acher pflüegt, wo ganz nah am Waldrand isch gläge. Aber nit öppe mit Maschine so wie hüt. Nei, denn isch der Pflueg no vo Ross zoge worde. Mi Vater der Pflueg it beidne Händ ghebt u dür e früsch bruun Härd gfüehrt, wo-n i plötzlich öppis grüens zwüsche es paar Härdbröcke entdeckt ha. I bi häre ga luege u ha im früsch ufpflüegte Härdbode es chlyses Grotzli entdeckt, chum grösser als mi offeni Hand isch es gsi u het fiini, lüchtend grüeni Eschtli gha. U das Grotzli het mi duuret. Wenn es da blibt lige, de stirbt es, han-i zum mir sälber gseit u has vorsichtig i beidi Händ gno. Aber itz, wohi dermit? I ha e grad Idee gha! Ob em Huus isch denn no e Pflanzplätz gsy, dert tuet das Grotzli ja niemerem öppis u cha es paar Jahr zfride wyterläbe, han-i dänkt. U ha scho im nächste Momänt am Rand vom Pflanzplätz es Loch grabt u das Grotzli süferli i Bode gsetzt.
Ätti u Müeti hei zerscht nid grad Freud gha. So e Tanne wachsi halt schnäll u gäb de Schatte im Garte, het’s gheisse. Aber dass i mi um das junge Pflänzli gsorget ha, das het se o gfröit. «Bhalt Du das Grotzli, es isch itz di Boum!», hei druf beidi gseit. U mi Tanne isch gwachse u ufgschosse, Jahr um Jahr. U so wie d Jahr si vergange, so isch mi Tanne grösser u chreftiger worde, mit schöne, dunkelgrüene Escht u mit eme Tüller, wo wyt i Himmel ufgragt het. Später isch der Pflanzplätz verschwunde, das Stückli Ärde isch wider Weidland worde u no später, won-i scho e junge Maa bi gsi, han-i es Bänkli zimmeret, wo hüt no de dert steit u wo Dir scho mängisch drumume gspilt heit.
Der erscht Schnee
Gly druf sch es de cho schneie. E chalte Morge isch es gsy, nach ere stärneklare Nacht mit em volle Silbermond uf sire Reis am wyte, nachtblaue Himmelszält. Mit em Tagesliecht si vom Weschte här d Schneewulche vom Jurä här cho und es isch no nid Mittag gsy, wo plötzlich Chinderstimme vor em Huus si z’ghöre gsi: «Es schneit, es schneit!». I ha ja scho mängisch i mim Läbe Schneeflocke gseh, aber glich isch es geng ume öppie bsunders. I bi vor ds Hus gstande u ha die fiine, chüele Flöckli im Gsicht gspürt. U i ha de Ching zuegluegt, wo voller Läbesfröid d Arme wyt hei uusgstreckt, sich im Kreis hei dräiht, grad so als ob si wie e Schneeflocke wette tanze. Der ganz Tag het es im eim furt gschneit u vor em Vernachte, het e lüchtend reini, wyssi Dechi ds ganze Land zuedeckt. Itz isch er da, der Winter. Nach em Znacht hei mir d Latärne azündet u sy ds Bord uf zur Tanne. Öppis ganz gheimnisvolls het üsi liebi Ärde itz umarmt. Ds Liecht vom Schnee, wo im Mondschyn glitzeret. Und es isch so still gsi, dass me het chönne ghöre, wie d Schneeflocke sich uf d Ärde hei gleit.
U wie isch das im nächste Momänt gange? Plötzlich isch es wyder lut u läbig worde. Der Peterli het drum e Idee gha! Är het e Plastigsack unger syre Jagge versteckt u dä itz mit eme Jutz füregnoh. U chum hei mir gmerkt, was är im Schild füehrt, het är dä Bitz Plastig usbreitet u isch höcklige ds Bord ab grütscht. Hui, isch das gange! Die angere Chind sy lut mit lache u rüefe hingernache gsprunge!
D Chrüpfe
U es paar Tag später het mi der Peterli grad no einisch überrascht. Churz vor em Vernachte isch es passiert, wo über der Egg der Aabestärn het afa glitzere. Und am Adväntschranz uf em Stubetisch hei itz scho drü Cherzli brönnt. «Grosätti, chum lueg, schnäll, schnäll!», het Peterli grüeft u denn zu der Tanne zeigt. U würklich, dert isch öppis gange. Es ganzes Grüppeli vo Reh isch uf em Wäg vo eim Waldrand zum angere bir Tanne verby cho u het dert e Momänt still gha. Villecht hei sy am Bode unter de wyte Escht no öppis z’frässe gfunge. Oder si hei eifach still gha zum warte. U tatsächlich isch e Momänt später no eis vo dene schöne bruune Tierli vor em dunkle Waldrand uftoucht. «So mängs Reh han i im mim Läbe no nie gseh», het Peterli ganz ufgregt grüeft u het mit grosse Ouge zum Hoger ufe gluegt Der Peter het drum Tier gärn gha, das het mir a däm Bueb immer bsungers guet gfalle.

Du chönntisch ihne öppis vom Höi bringe, die Tier hei itz gwüss o Hunger, han i druf zu Peter gseit. U der Bueb, aber o die angere Ching sy begeischteret gsi vo dere Idee. Scho am angere Morge hei mir us es paar Brätter u Stäcke e eifachi Chrüpfe zimmeret u se zäme zur Tanne brunge. Miriam, Peter u die angere Ching hei druf e Arfete Höi der Hoger uf treit und i die Chrüpfe gleit. I ha derby zuegluegt u müesse stuune, wie die Bursch das Höi sorgfältig, ja grad adächtig i das Holzgstell ine büschelet hei. Druf sy mir wider düre e Schnee der Hoger ab. Won es het afa dämmere, hei d Ching immer wider zur Tanne gluegt, ob nid öppe eine vo dene Waldbewohner z’gseh isch. Aber nüt isch passiert.
Gli druf, am nächschte Tag, es isch no immer klar gsy u het nüt gschneit, isch am Morge es Reh us em Wald cho. U denn no eis. Beidi si zur Tanne, hei vorsichtig am Heu gschnupperet u denn es paar Bitze usezupft. Zwöi witeri si druf zwüsche de Waldtanne fürecho u hei sich derzue gsellt. Plötzlich si es es halbs Dotze Reh um die Chrüpfe ume gstande. U es isch chum e halb Stund vergange, da isch ds ganze Höi furt gsy u d Reh si wider im Schutz vom Wald verschwunde. O am nächste Tag hei d Ching die Reh dörfe füetere. So si die Tage vo der letschte Adväntwuche vergange, die heilige Nacht u Wiehnachte sy cho. Am Tag vom heilige Abe isch es es läbigs Cho u Ga gsi. Mängs het müesse vorbereitet si u d Ching sy läbig u voller Erwartig dür ds Hus i und us: «Hüt chunt ds Christchind, scho hüt am Aabe!» Ersch im Verlouf vom Namittag isch es ruhiger worde, D Mönsche si still worde und es isch eim vorcho, als wärd d’Ärde a däm gsungere Aabe, vo öppis heiligem berüehrt.
Aber plötzlich isch Peterli cho z’springe, er het e Sack mit Höi derby gha u isch gäg em Hoger zue. Peter, wo wosch de no hi, han i gfragt, won är düre e Schnee isch. «Mit em Höi zur Chrüpfe», het är gantwortet und isch mit ärschtige Schritte der Bärg uf. Aber denn het är no einisch zrügg gluegt un gseit: «D Reh messe doch o Wiehnachte ha.»
Spät i der Nacht, d Ching si scho lang im Bett gsy, da han i no einisch dür ds Fänschter zu mire Tanne gluegt. D Cherzli am Boum i der Stube, die si erlosche, ganz still isch es im Huus worde. Aber dert, bi der Tanne, dert het öppis angers glüchtet, d Stärne. Mänge dervo het dür d Escht glitzeret u es het usgseh, als ob da e grosse Wiehnachtsboum uf der Egg steit. Aber wie isch de das mit dene Stärne? Hei die nid o glüchtet, wo der Heiland isch uf d Ärde cho? Die gliiche Stärne si es doch gsy, wo d Hirte u d Chünige i dere Nacht hei gseh. U i däm Momänt isch es mir vorcho, dass all das, wo i der heilige Nacht isch passiert, ganz nach zu üs häre isch cho.