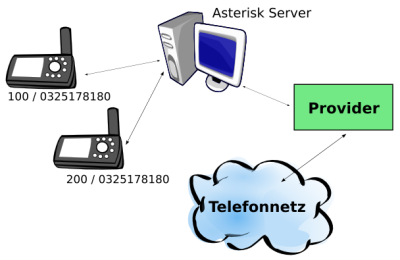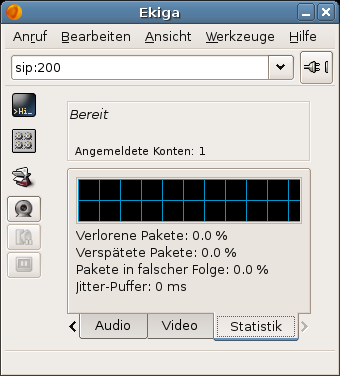«Ein Ritter habe in voller Rüstung seiner Liebsten Blumen gepflückt, sei ins Wasser gefallen und ertrunken. Die Dame bekam den blauen Blumenstrauss und blieb ihr Leben lang dem Toten treu.» Das klingt romantisch und das will es auch, denn die Geschichte stammt aus einem Buch zur Blumensprache. Die Blumen, die der Unglückliche sammelte, waren natürlich Vergissmeinnicht, das zarte Blümchen also, das durch seine kleinen, tiefblau leuchtenden Blüten nicht erst seit der Romantik auch von Königen bewundert und von Dichtern besungen wird. Selbst der Dichterfürst Göthe hat der kleinen Frühlingsblume mehrere Gedichte gewidmet. Im Blümlein Wunderschön zeichnet der Blumenliebhaber in den schönsten Farben das Bild eines gefangenen Grafen, der einsam im Verlies verharrt und nur eine Sorge hat: dass seine Geliebte ihn nicht vergisst. So schweift sein Blick vom Turm herab und sucht nach der Blüte, deren Anblick er mit der Gewissheit gleichsetzt, dass seine Erwählte ihm die Treue hält.
«Ein Ritter habe in voller Rüstung seiner Liebsten Blumen gepflückt, sei ins Wasser gefallen und ertrunken. Die Dame bekam den blauen Blumenstrauss und blieb ihr Leben lang dem Toten treu.» Das klingt romantisch und das will es auch, denn die Geschichte stammt aus einem Buch zur Blumensprache. Die Blumen, die der Unglückliche sammelte, waren natürlich Vergissmeinnicht, das zarte Blümchen also, das durch seine kleinen, tiefblau leuchtenden Blüten nicht erst seit der Romantik auch von Königen bewundert und von Dichtern besungen wird. Selbst der Dichterfürst Göthe hat der kleinen Frühlingsblume mehrere Gedichte gewidmet. Im Blümlein Wunderschön zeichnet der Blumenliebhaber in den schönsten Farben das Bild eines gefangenen Grafen, der einsam im Verlies verharrt und nur eine Sorge hat: dass seine Geliebte ihn nicht vergisst. So schweift sein Blick vom Turm herab und sucht nach der Blüte, deren Anblick er mit der Gewissheit gleichsetzt, dass seine Erwählte ihm die Treue hält.
Die Blumen auf den Wiesen rund um das Schloss werden auf den suchenden Grafen aufmerksam und richten tröstende Worte an den Gefangenen. Allen voran natürlich die Königin der Blumen, die stolze Rose, die sich ihres Wertes durchaus bewusst ist. In der Blumensprache ist sie in roter Farbe nicht nur ein Symbol der Liebe sondern auch des Sieges. Zu ihr gesellt sich die Lilie, die durch ihr leuchtendes Weiss für Reinheit und Licht steht. Und während die beiden Blumen, zu denen sich inzwischen auch die Nelke dazugesellt hat, um die Gunst des Grafen werben, ertönt plötzlich und kaum hörbar eine Stimme aus dem Verborgenen. Es ist das süss duftende Veilchen, das wie keine andere Blume für Bescheidenheit steht. Erst nach anfänglichem Zögern spricht das Veilchen zum Gefangenen: «Wenn ich es bin, du guter Mann, wie schmerzt michs, dass ich hinauf nicht kann, Dir alle Gerüche senden!»
Di schöne Sitte, Blumen zu schenken, Gefühle und Wünsche mit einer Blüte auszudrücken, ist uralt. Schon vor 10.000 Jahren gaben unsere Vorfahren ihren Verstorbenen Blumen mit ins Grab. Ein wichtiger Hinweis darauf, dass Blumengeschenke auch bei anderen Anlässen gebräuchlich waren.
Blumen als Geschenk wecken Emotionen, sind stets etwas Besonders und werden selbst Kostbarkeiten wie Gold und Edelsteinen vorgezogen. Seit Menschengedenken ist das Überreichen einer Blüte oder auch nur eines Zweiges, wenn es mit Bedacht geschieht, ein untrügliches Zeichen der Wertschätzung und der Zuneigung. Warum ist das so? Etwa, weil Blüten gerade durch ihre Vergänglichkeit ein Symbol für das Ewige, Unvergängliche sind? Oder weil Pflanzen kein materielles Geschenk im eigentlichen Sinne sind, sondern vielmehr ein Sinnbild für Gefühle. Wer Blumen schenkt, bestätigt der oder dem Beschenkten einen tieferen Sinn für das Zarte, für das Sensible und Feinsinnige. Ein Blumengeschenk ist stets persönlich und einzigartig.

Im Science Fiction Film Buck Rogers wird die Erde von einer mächtigen, ausserirdischen Königin besucht. Bei dem Gipfeltreffen sind zahlreiche Fürsten und Regenten aus fernen Welten anwesend und überbieten sich gegenseitig durch wertvolle Geschenke an die Königin. Zuletzt wird der Held der Geschichte, Buck Rogers, vorgelassen. Er überreicht der Fürstin eine rote Rose und beschämt damit alle.
Doch zurück zum Vergissmeinnicht. Es ist in der Sprache der Blumen weniger das Symbol des Angedenkens, diese Rolle kommt dem Stiefmütterchen zu. Wer Vergissmeinnicht verschenkt, versieht seine Gefühle mit einem ersthaften, blauen Ausrufezeichen. Alle Namenslegenden berichten von wahrer Liebe. So steht es in «The Language of Flowers» von Sheila Pickles und in der «Neuen vollständigen Blumensprache» aus dem 19. Jh.
Gerade die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts war durch die in voller Blüte stehende Romantik die Zeit der Blumensprache. Sie erfreute sich nicht nur an Höfen, sondern auch im bürgerlichen Leben an zunehmender Beliebtheit. Geschenkt wurden nicht nur Sträusse oder Blüten, sondern auch einzelne Blätter einer Blüte. Wer eine baldige Antwort wünschte, legte seinem Brief einen Grashalm bei, ein Kleeblatt mahnte zur Vorsicht. Mit roten und weissen Rosenblättern wurde Bejaht und Verneint. Auch die Präsentation war bedeutend: Eine nach unten gerichtete Blüte bedeutete das Gegenteil, auch ein um dem Strauss gewickeltes Band enthielt eine Botschaft.
Im ausgehenden 19. Jh. verlor die Blumensprache zunehmend ihre Popularität, die filigrane und facettenreiche Symbolik verschwand wieder. Heisst das, dass beim Schenken von Blumen nicht mehr auf die Symbolik geachtet werden muss? Gewiss nicht. Aber wir haben es heute auch wesentlich einfacher als unsere Ahnen aus der Zeit der Romantik. Wer sich an einige wenige und einfache Regeln hält, kann keinen Fehler machen.
In unserer Zeit ist der Sinn für das Schöne in den Vordergrund gerückt. Wichtig ist die harmonische Zusammenstellung mit einer bedeutungsvollen Farbe: Rot für Liebe, Rosa für Zärtlichkeit, Blau für Treue und Sehnsucht, Weiss für Reinheit und geistige Schönheit, Gold für Glück. Einer wachsenden Beliebtheit erfreut sich die Sonnenblume, die für Licht, Freude und Glück steht.
Der Efeu ist kein Schmarotzer, er hat eigene Wurzeln, doch sucht er sich einen Baum, an dem er sich festhalten und an dem er emporwachsen kann. So ist diese schöne Pflanze zum Sinnbild der Treue geworden; auch deswegen, weil sie während der kalten Jahreszeit grün bleibt. Überall in unserer Umgebung entdecken wir Buchsbäume, die gerne aus Hecken verwendet werden. Erst in jüngster Zeit wurde der Buchs wieder als Zierpflanze entdeckt. Was weniger bekannt ist: Buchs ist ein Symbol der Hoffnung. Sehr beliebt sind bei Herrn und Frau Schweizer auch die leuchtend roten Geranien und Margeriten in verschiedenen Farben, im Frühling Stiefmütterchen, Tulpen und Primula, die liebevoll «Primeli» genannt werden, Rosen und im Herbst Astern. Ihre Symbolik kann in den oben erwähnten Büchern oder auf Wikipedia nachgeschlagen werden. Doch ungeachtet der von uns zugesprochenen Bedeutung sind sie wie alle ihre Geschwister vor allem eines: Kinder des Himmels und Botschafter aus einer zaubrischen Welt.







 Der
Der